Wie hilft die Psychoonkologie?
Die Psychoonkologie hilft Menschen, die aufgrund einer Krebsdiagnose wie zum Beispiel Kehlkopfkrebs vor großen emotionalen Herausforderungen stehen. Die oft notwendige Entfernung des Kehlkopfs (Laryngektomie) führt zu tiefgreifenden körperlichen Veränderungen – wie dem Verlust der eigenen Stimme und der Umleitung der Atmung über eine Öffnung am Hals (Tracheostoma). Viele Betroffene fragen sich in dieser Situation: „Wie kann ich ohne meine Stimme kommunizieren?“ oder „Wie wird das Tracheostoma meinen Alltag verändern?“ Solche Sorgen und Ängste sind verständlich und können stark belasten – manchmal so stark, dass die Patienten zusätzliche psychologische Unterstützung benötigen.
In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Psychoonkologen Menschen mit Krebs in jeder Phase der Erkrankung begleiten. Sie helfen den Patienten, Bewältigungsstrategien zu entwickeln und den Weg zurück in den Alltag mit Zuversicht zu meistern.

Was ist Psychoonkologie?
Die Psychoonkologie gehört zum Fachbereich der Onkologie und setzt sich mit den emotionalen und sozialen Herausforderungen einer Krebserkrankung auseinander. Dabei arbeiten Experten wie Ärzte, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter oder Pädagogen eng zusammen, um die Lebensqualität und das seelische Wohlbefinden von Krebspatienten zu verbessern. Die Therapeuten helfen den Patienten, die emotionale Belastungen zu verringern und persönliche Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Aber auch praktische Fragen zum Alltag werden geklärt – beispielsweise zum Wiedereinstieg ins Berufsleben oder zu sozialrechtlichen Fragen. Darüber hinaus beschäftigt sich die Psychoonkologie auch mit der Forschung, um besser zu verstehen, wie psychische und soziale Faktoren eine Krebserkrankung beeinflussen. Dieses Wissen ist wichtig, um passgenaue Hilfsangebote für Patienten zu entwickeln.1
Was belastet Krebspatienten am häufigsten?
Verschiedene psychosoziale Belastungen können in jeder Phase der Erkrankung auftreten und sich gegenseitig beeinflussen. So können sich körperliche Schmerzen auf die Seele auswirken. Aber auch umgekehrt können depressive Verstimmungen zu einem erhöhten körperlichen Schmerzempfinden führen. Schlimmstenfalls führen psychosoziale Belastungen zu einer psychischen Erkrankung (zum Beispiel Depression oder Angststörung) mit Rückzug und Isolation. Zögern Sie deshalb nicht, Ihr Behandlungsteam anzusprechen, falls Sie oder Ihre Bezugspersonen Hilfe benötigen.1

Psychosoziale Belastungen bei Krebs
- Körperliche Probleme verursacht durch das Tracheostoma, aber auch Symptome wie Schwäche, Schmerzen oder Erschöpfung (Fatigue).
- Seelische Probleme wie Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit bis hin zu Depressionen.
- Soziale Probleme wie Einsamkeit, Schwierigkeiten in Partnerschaft und Beziehungen, finanzielle Sorgen sowie Herausforderungen am Arbeitsplatz oder beim Wiedereinstieg in den Beruf.
Unterstützung in jeder Krankheitsphase
Bei einer Krebserkrankung müssen Sie Ihre Ängste und Sorgen nicht allein durchstehen. In jeder Phase der Erkrankung steht Ihnen und Ihren Bezugspersonen der Zugang zur Psychoonkologie offen. Teilen Sie Ihrem Behandlungsteam frühzeitig ihre emotionalen Belastungen mit. Folgende Beispiele zeigen, wie die Psychoonkologie Patienten unterstützen kann:1
Bei der Diagnose
Die Diagnose Krebs im Mund-Hals-Bereich löst bei Betroffenen eine Vielzahl intensiver Gefühle aus. Häufig sind Schock und Fassungslosigkeit die ersten Reaktionen, gefolgt von Zukunftsängsten und Sorgen um die Familie. Manche Menschen kämpfen mit Schuldgefühlen oder versuchen, die Diagnose zu verdrängen. Auch Unsicherheit darüber, wie es in der Behandlung weitergeht, belastet viele Patienten. Psychoonkologische Fachkräfte helfen Ihnen in dieser Situation, Ihre Gedanken zu ordnen und die oft überwältigenden Informationen besser zu verstehen. In einem geschützten Rahmen unterstützen sie Sie dabei, Ihre Gefühle zu reflektieren und gemeinsam Wege zu finden, mit der neuen Situation umzugehen. Nun ist es wichtig zu wissen, dass sich zwar Ihr Alltag in Zukunft ändern wird – es ist aber trotzdem möglich, glücklich und mit einer hohen Lebensqualität zu leben. Menschen mit Tracheostoma können Kommunizieren, Reisen und auch manchen Hobbys nachgehen.1, 2
Während der Therapie
Psychoonkologen unterstützen Sie in dieser Phase dabei, Ihre Gefühle anzunehmen und den Umgang mit den körperlichen Veränderungen durch Operation, Chemotherapie, Strahlen- oder Immuntherapie zu erleichtern. Sie helfen Ihnen, Ängste abzubauen und Vertrauen in Ihre Fähigkeiten zu gewinnen, damit Sie Schritt für Schritt Routine im Umgang mit dem Tracheostoma entwickeln. Die Fachkräfte begleiten Sie gemeinsam mit Logopäden auf dem Weg zu einer neuen Stimme und stärken Sie darin, Ihre Identität trotz der körperlichen Veränderungen zu bewahren. So erhalten Sie die Unterstützung, die Sie brauchen, um Ihren zukünftigen Alltag mit mehr Sicherheit und Zuversicht anzugehen. 1, 2
Nach der Behandlung
Wenn die Therapie abgeschlossen ist, stehen Patienten oft vor der Herausforderung, sich an einen veränderten Alltag anzupassen. Psychoonkologen unterstützen dabei, Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln und einen neuen Lebenssinn zu finden. Dies kann die Diskussion über persönliche Ziele und Werte beinhalten, aber auch die Unterstützung bei der sozialen Teilhabe und der Bewältigung von Alltagsproblemen wie zum Beispiel die Haushaltsführung oder Erledigung von Einkäufen. Auch der Wiedereinstieg in den Beruf ist möglich und wird von den Psychoonkologen begleitet. 1, 2
Beim Wiederauftreten der Krebserkrankung
In dieser extrem belastenden Phase stehen Psychoonkologen dem Patienten emotional bei und helfen, mit existenziellen Sorgen und Zukunftsängsten umzugehen. Sollte sich der Krebs trotz Behandlung nicht mehr kontrollieren lassen, fängt Sie die Psychoonkologie auf und begleitet Sie durch die verbleibende Lebenszeit.1
Interessiert an mehr Ratschlägen wie diesen?
Jetzt Anmelden für unseren Newsletter „Mittendrin“Patientenleitlinie Psychoonkologie
Die Patientenleitlinie Psychoonkologie erklärt verständlich, welche Belastungen und Folgen eine Krebserkrankung mit sich bringen kann. Sie zeigt auf, wie Psychoonkologen den seelischen Stress erkennen und behandeln. Mit diesem Wissen sind Sie gut vorbereitet, um offene Gespräche mit Ihrem Arzt zu führen und gezielt die Fragen zu stellen, die Ihnen wichtig sind.
Methoden der Psychoonkologie
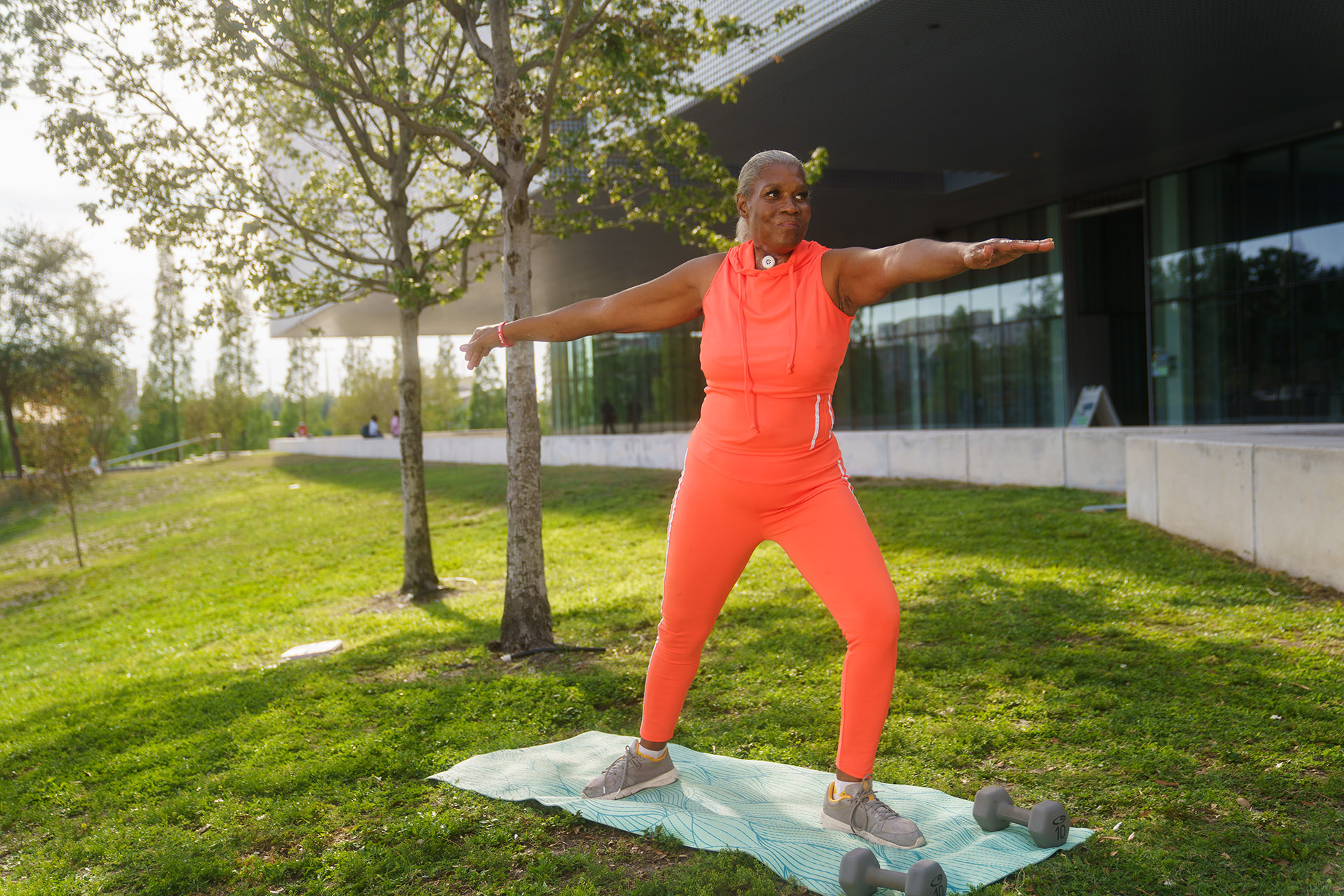
Die Psychoonkologie bietet eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten, die an die individuellen Bedürfnisse eines Krebspatienten angepasst sind:1
- Psychotherapie: In einem geschützten Rahmen können Patienten ihre Gefühle und Ängste ausdrücken, was zur emotionalen Entlastung beiträgt. Verschiedene Therapieformen wie Psychoanalyse oder kognitive Verhaltenstherapie helfen dabei, individuelle Strategien zur Krankheitsbewältigung zu entwickeln.
- Psychoedukation: Schulungen während der Rehabilitation oder ambulanten Nachsorge informieren über den Krankheitsverlauf und die Auswirkungen des Tracheostomas – denn Wissen macht stark.
- Atemübungen: Durch bewusste Kontrolle der Atmung können Sie Stress abbauen und mehr Ruhe im Körper spüren.
- Autogenes Training: Durch Selbstbeeinflussung (Autosuggestion) lernen Betroffene, mentale und körperliche Entspannung zu erreichen.
- Progressive Muskelentspannung nach Jacobson: Durch gezieltes An- und Entspannen einzelner Muskelgruppen werden körperliche und mentale Spannungen abgebaut.
- Meditation: Diese Achtsamkeitsübung hilft, die Gedanken auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und den Geist zu beruhigen.
- Yoga: Eine Kombination aus Bewegung, Atemübungen und Meditation bringt Körper und Geist in Einklang.
- Künstlerische Therapien: Kreative Ausdrucksformen wie Malen, Musizieren oder Tanzen unterstützen dabei, innere Konflikte zu verarbeiten und neue Perspektiven zu gewinnen – oft ganz ohne Worte.
Wie erkenne ich, dass ich Hilfe benötige?
Nicht jeder Patient mit Krebs entwickelt seelische Probleme. In Studien wurde jedoch belegt, dass 60 % aller Krebserkrankten unter einer hohen psychischen Belastung leiden. Etwa die Hälfte der Krebspatienten leiden unter starken Ängsten – hauptsächlich vor dem Fortschreiten der Erkrankung oder einem Rückfall. Mehr als die Hälfte aller Krebspatienten erleben Episoden depressiver Verstimmungen oder Niedergeschlagenheit. Diese Symptome können von allein zurückgehen. Manchmal entwickelt sich aber auch behandlungsbedürftige Erkrankung. Sprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrem Behandlungsteam, wenn Ihre Beschwerden über eine längere Zeit andauern oder sehr stark sind. Hinter einer andauernden Erschöpfung kann sich beispielsweise eine Depression verbergen. Auch wenn kleine Alltagshandlungen plötzlich als unüberwindbare und kräftezehrende Herausforderungen wahrgenommen werden, sollten Sie zeitnah mit Ihrem Behandlungsteam sprechen.1
Hilfe annehmen ist kein Zeichen von Schwäche. Mit einer psychoonkologischen Begleitung haben Sie die Chance, wieder Ihre Lebensqualität zu steigern und neuen Lebensmut zu fassen.
Info: Das Distress-Thermometer
Mit diesem einfachen und leicht verständlichen Kurztest lassen sich aktuelle psychosoziale Belastungen (englisch „distress“) bei Krebspatienten feststellen. Auf einer Skala von 1 bis 10 geben Patienten an, wie stark Sie sich in bestimmten Situationen belastet fühlen. Das Testergebnis zeigt an, in welchen Lebensbereichen ein Patient Hilfe benötigt.1
Wie erhalte ich psychoonkologische Unterstützung?
Zertifizierte Zentren der Deutschen Krebsgesellschaft
Bei Verdacht auf Krebs oder einer bestätigten Diagnose werden Patienten meist an ein von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziertes Behandlungszentrum überwiesen. Patienten können auch selbst auf OncoMap nach spezialisierten Zentren in Ihrer Nähe suchen. In diesen hochspezialisierten Behandlungszentren sind psychoonkologische Angebote fester Bestandteil der Patientenversorgung. Fragen Sie am besten direkt in der Klinik nach, wenn Sie oder Ihre Bezugspersonen Unterstützung benötigen.
Psychosoziale Krebsberatungsstellen
Im Rahmen einer ambulanten Behandlung stehen kostenfreie psychosoziale Krebsberatungsstellen bereit – sowohl für Betroffene als auch für Bezugspersonen. Informationen zu Beratungsstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie telefonisch über das INFONETZ KREBS der Deutschen Krebshilfe.
Ambulante Psychotherapie
Bei anhaltenden Ängsten oder Belastungen kann eine ambulante Psychotherapie unterstützen. Diese individuelle Therapie geht weit über die Beratung hinaus und bietet regelmäßige Gespräche – auch über einen längeren Zeitraum. Speziell geschulte Therapeutinnen und Therapeuten finden Sie im Adressverzeichnis des Krebsinformationsdienstes.
Interessiert an mehr Beiträgen wie diesen?
Dann melden Sie sich für unseren Newsletter „Mittendrin“ an. Viermal im Jahr erhalten Sie praktische Alltagstipps, verständliche Neuigkeiten und echte Geschichten aus der Community – direkt in Ihr Postfach.
Jetzt AnmeldenQUELLEN:
1. Leitlinienprogramm Onkologie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) (2023). Patentenleitlinie Psychoonkologie. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Patientenleitlinien/Patientenleitlinie_Psychoonkologie_175v101.pdf
2. Grosse-Thie, C. (2021). Psychoonkologische Versorgung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren. https://www.kopf-hals-mund-krebs.de/wp-content/uploads/2021_01_MKG_Chirurg_Psychoonkologische_Versorgung.pdf